|
Mein erster Wienaufenthalt, wann war er? 1990? 1991?
Nach
der Grenzöffnung wollten meine Frau und ich im Rahmen des
finanziell Möglichen und der Erreichbarkeit mit unserem PKW
Trabant das westliche Ausland bereisen. Die Bundesrepublik hatte
Zeit, man sollte deutsch sprechen und wir wollten keinen
Verwandtenbesuch absolvieren.
Viele
Erinnerungen gaukeln durch die Jahre. Was würden wir heute noch
von Wien kennen, hatten wir damals die Bauten Gottfried Sempers
wahrgenommen?
Wir
glauben, uns ging damals alles zu schnell und Unmengen an Eindrücken
haben uns umgeworfen.
Nicht
unbedingt pompös habe ich die Ankündigung der Wienreise in
Erinnerung. Fast als Normalität im Rahmen der vielen lukrativen
Veranstaltungen des Gottfried Semper Club Dresden e.V.. Der
Vorstand verspricht jedoch eine herausragende und würdige
Clubveranstaltung in Vorbereitung auf die Sempertage 2003, ja
sogar den Auftakt für eine einmalige Semperwürdigung, die ihren
Höhepunkt mit dem Besuch seiner Grabstätte in Rom 2004 erreichen
wird.
Wenige
Tage darauf erscheint unser Clubprogramm. Auf dem Flyer sind viele
Stätten zu sehen, die wir besuchen werden, das Kaiserforum, das
Kunsthistorische und Naturhistorische Museum, das Burgtheater und,
und, und.
Ja,
Wien war neben den Exkursionen nach Potsdam Sanssouci, Wörlitz,
Bad Muskau oder Weimar die erste überhaupt über die Grenzen
Deutschlands hinaus, vier stressige Tage im Mai, 250 € Pro
Clubmitglied und Ehepartner etwas mehr. Darin enthalten ist die
Busreise, die Übernachtung im *** Hotel mit Frühstück sowie die
Führung an allen Tagen. So Teuer, so gut. Meine Frau und ich, wir
wollten dieses Ereignis begleiten.
Das
Schicksal entschied anders. Nachdem wir die Semper-Exkursion Wien
gebucht hatten, wurde die Genehmigung des Urlaubsantrags meiner
Frau zurückgenommen. Beratung war angesagt und unser gemeinsames
Ergebnis stand fest. Ich sollte Ersatz finden, eine Person, die
mich auf der Reise begleitet. Aber welche?
Der Anreisetag
Wir
stellten unser Auto in einem Wohngebiet ab. Es sollte geschützt
vor Beschädigungen und befreit von lästigen Parkgebühren sein.
Bis zum Treffpunkt am Kurländer Palais ist es eigentlich nicht so
weit. Der Weg mit Gepäck für vier Tage erscheint uns aber
unendlich. Schweigend und etwas übermüdet laufen wir über die
sich belebenden Strassen.
Endlich
Wirklichkeit. Wir waren am Ausgangspunkt unserer Reise angelangt.
Keine Angst mehr im Nacken vom Verschlafen oder von einer Panne,
von einer Krankheit, die einen über Nacht ergreifen kann. Und,
dazu noch überpünktlich, die ersten Reisegäste, kurz nach
halbsechs.
"Irrtum
meine Herren“, mit diesem Eingeständnis müssten wir leben,
wenn man uns in den traditionellen Busstandort eingeweiht hätte.
Dieser lag etwa in 100 m Entfernung und vom Kurländer Palais
aufgrund der Baustelle nicht direkt einsichtig. Dank eines
ebenfalls verirrten Clubmitglieds wurden wir ab jetzt und ab heute
mit dem Bekannten Unbekannten vertraut gemacht und durften
uns zu den Club-Reiseprofis zählen.
Der
Bus der Taeter Tours machte auf mich einen angenehmen Eindruck. Schlicht die Werbung und unaufdringlich
 die Farbe in einem Altweiß,
gänzlich abweichend von meinen Vorstellungen über Reisebusse.
Wir lassen unser Gepäck fallen. die Farbe in einem Altweiß,
gänzlich abweichend von meinen Vorstellungen über Reisebusse.
Wir lassen unser Gepäck fallen.
Von
den 44 Reisegästen waren wir also nicht das geglaubte Vorauskommando, sondern, vernachlässigen wir die wiederum
erstgenommene Rolle unseres Vorsitzenden als „Zuletztkommer“
ein wenig, schlicht weg die letzten. Wir schlängelten uns
vorsichtig durch den gefüllten Bus und begrüßten dabei die
Clubfreunde in einer für uns nicht üblichen Art von
Allgemeinheit.
Die
Plätze auf der letzten Bankreihe konnten wir uns aussuchen –
links, mitte oder rechts. Ich entschied mich für die
Beifahrerseite und beobachtete, wie sich viele Clubfreunde auf dem
Gehweg angeregt unterhielten und unser Gepäck verstaut wurde. Mir
war nur nach sitzen bleiben.
Ich
fühlte mich erleichtert, als sich der Bus 06.09 Uhr Richtung
Altenberg in Bewegung setzte. Es ist wie bei meinen anderen
Busreisen: die üblichen Einweisungen über Handhabung der Sitze
und Lehnen sowie Toilettennutzung nur im äußersten, äußersten
und bitte nur im äußersten Notfall, die Kontrolle der
Personaldokumente auf ihre Gültigkeit und... Und!
Unser
Kapitän, Pilot, Chauffeur oder wie man ihn nennen möchte, hatte
doch wirklich verpasst, sich uns vorzustellen. Eine
Vergesslichkeit, die er am Hautbahnhof wieder gut machte. Herr
Kaden, wie wir dann erfuhren, hatte als großgewachsener, gebräunter,
schlanker und gutaussehender junger Mann sicherlich von Anbeginn
bei allen Frauen den Bonus der ganzem Welt auf seiner Seite und
die, vielleicht von Natur aus skeptischen Männer, überzeugte er
spätestens durch sein fahrerisches Können und freundliches
Auftreten auch ihnen gegenüber.
Natürlich
hatte ich von den Anreisestunden nicht viel erwartet. Selbst wenn
ich mir in meinen Routenplaner „LKW schnell“ eingetragen und
somit in etwa unsere Fahrzeit ermittelt hätte, die Reisezeit nach
Wien richtet sich nach den Gegebenheiten der beiden Grenzüberfahrten.
Und die sind unkalkulierbar. Also abwarten und auf gute Laune der
Grenzbeamten hoffen.
Die
Zeit bis zu unserer Ankunft in Wien um 16.25 Uhr verging recht
schnell. Es gibt ja immer etwas zu erzählen und zu entdecken:
Clubmitglieder, die sich lange nicht gesehen haben,
Reiseerinnerungen aus Wien, die man gern und voller Stolz
preisgeben wollte, Grüße, die unbedingt auszurichten waren, Präzisierungen
zum Veranstaltungsablauf und in unserem Falle eine nette Begrüßung
unseres Reisegastes. Der Person, die ich über Zustimmung durch
meine Frau mit in unser gebuchtes Doppelzimmer nehmen durfte.
Rayk ist Student für Informatik an der FHTW Berlin.
Im Rahmen seiner Diplomarbeit "Entwicklung eines interaktiven
Informationssystems zu den Semperwerken mit dem Schwerpunkt der
3D-Visualisierung der Villa Rosa" wird er uns ein 3D-Modell
des Hauses und eine komplette Kamerafahrt durch die Villa
erstellen. Schon der Gedanke daran, dass wir uns in
Räumlichkeiten wieder finden werden, die kein Mensch mehr betreten kann,
lässt mich etwas erschauern. Wir werden viel darüber diskutieren.
Es
ist noch ein schöner Nachmittag geworden. Die Sonne hatte sich
kurz vor der Österreichischen Grenze durchgesetzt, so dass uns
Wien mit all ihren Reizen empfängt.
Ihren
ersten Willkommensgruß als belebte, pulsierende und engbebaute
Metropole bringt und Österreichs Hauptstadt entgegen, als unser
Bus durch Klaus Tempel, Lucas Müller und Klaus Mjetk in
Gemeinschaftsarbeit vorsichtig und mit kleinen Umwegen durch die
Stadtteile zu unserem Hotel gelotst wird. Wir müssen, oder besser
gesagt Herr Kaden muss sich mühevoll durch die mit Autos übersäten
kleinen Straßen kämpfen. Alles geschieht mit einer
bewundernswerten Perfektion.
Wir
stehen vor dem, wie im Hotelprospekt nachzulesen ist, familiären
City-Hotel im Herzen Wiens, dem Wilhelmshof. Hinter
der detailgetreurenovierten Fassade unseres 1896 erbauten Hauses
verbirgt sich ein komfortables, modern ausgestattetes Stadthotel
der gehobenen Mittelklasse.
Dem
immer wieder aufregenden Prozess der Zimmerschlüsselvergabe folgt
die Auflösung unserer Reisegruppe auf die gemütlichen und großteils
neu renovierten Zimmer.
Es
waren noch drei Stunden Zeit bis zu unserem gemeinsamen
Abendessen, als Rayk und ich wir uns zu Fuß ins Zentrum der Stadt
aufmachten. Wir begeben uns förmlich in ein Gewühl von
Flaneuren. Auf dem Stephansplatz, dem Petersplatz und auf der Kärntner
Straße zelebrieren eine Vielzahl von Schauspielern, Sängern und
Artisten ihre originellen Darbietungen und versetzen die gesamte
Innenstadt in einen Schauplatz künstlerischer Lustbarkeiten. In
diesem faszinierend imposanten Rahmen erleben wir einen
unvergesslichen Tagesausklang voll Wiener Charme und Lebensfreude.
Unser
erster Tag in Wien
Mit
dem Fahrstuhl erkundeten wir das Hotelgebäude und werden überrascht,
dass wir in so kurzer Zeit den Frühstücksraum erreichen. Der Weg
auf unser Zimmer im zweiten Stock, den wir am Vortag allein über das
Treppenhaus genommen haben, war ziemlich umwegig und verwinkelt, da er
unterschiedliche Gebäudestrukturen und -ebenen einschloss. Fortan
bewegten wir uns nur noch über das erwähnte moderne Transportmittel
durch das Haus und hatten etwas entdeckt, dessen Wert wir eigentlich
erst am Abend so richtig schätzen lernen sollten.
Das
Kännchen Kaffee ist fast leer. In der Regel dauert mein Frühstück
so lang. Ich lies mir jedoch eine weitere Tasse servieren, so
faszinierte mich der Kontrast. Einerseits die Wiener Mundart des
Hotelpersonals und und dessen lockere Herangehensweise an die
aufkommende Hektik. Andererseits das typisch Vertraute aus dem
Sachsenlande: Die lange und laute Diskussion über die Auswahl des
geeigneten Tisches, die Reservierung von Plätzen für die hoffentlich
sich bereits auf dem Weg zum Frühstücksbüffet befindlichen
Begleiter, die Abstimmung zu dem, was heut einem am frühen Morgen
besser bekommen würde, Tee oder Kaffee und/oder die Bewunderung
dessen, was sich der gegenübersitzende Partner anlässlich des
bevorstehenden Tages an Kleidung hat einfallen lassen.
Und
tatsächlich, es war augenscheinlich, dass sich unsere Clubfreunde,
vielleicht im Wissen um die Eleganz dieser Stadt und dem Flair ihrer
Bewohner, sich besonders auffällig und hübsch zurechtgemacht haben.
Jeder hiesige Charmeur hätte bestimmt viel darum gegeben, eine unserer Damen
durch Wien zu begleiten.
Jetzt
aber heißt es auf den Boden der Realität zurückzukehren und dem Ruf
unseres Vorsitzenden zu folgen, der lautet: höchste Disziplin,
vollste Konzentration und geballte Aufmerksamkeit zu dem, was heute
auf uns zukommt.
Auf dem Weg zum
ersten elektrisch beleuchteten Monumentalbau Wiens, dem Burgtheater, tut sich eine Ära
auf – die Ringstraßen-Ära. Die Rede unseres Vorsitzenden kreist um
Fakten und historische Zusammenhänge, während unsere Fahrt vorbeiführt
an Museen, an der Hof- bzw. Staatsoper, am Reichsratsgebäude, in dem
heute das österreichische Parlament seinen Sitz hat, an der neuen
Universität und vielen andern Sehenswürdigkeiten. Am Ende wissen wir
immerhin auch, dass, nachdem Kaiser Franz Joseph 1857 den Entschluss zur
Auflassung der städtischen Befestigungen gefasst hatte, bestes Bauland freiwurde. Es handelte sich dabei nicht
nur um den Ort der Stadtmauer selbst, vielmehr wurde der gesamte alte
militärische Rayon der Befestigungen, somit ein breiter Gürtel rings
um die Innenstadt, einbezogen. Bis heute verbindet man deshalb den
Namen Wiens international mit dem Begriff der „Ringstraße“.
Vor dem Wiener Burgtheater werden wir von Herrn Heindel, seines Amtes Gebäudedirektor, bereits erwartet.  Er kennt das
Haus seit vielen Jahren und im Besonderen die damit verbundene
Geschichte. Natürlich hätte er uns gern die vielen plastischen
Figuren gleich zu Beginn an der Außenfassade gezeigt. Vor allem die
berühmten neun Dichterbüsten über den Fenstergiebeln mit Friedrich
Halm, Franz Grillparzer, Friedrich Hebbel, Friedrich Schiller, Johann
Wolfgang Goethe, Gotthold Ephraim Lessing, Moliere, William
Shakespeare und Calderon de la Barca. Doch eine planmäßige
Rekonstruktion der Außenhaut machte uns einen Strich durch die
Rechnung. Er kennt das
Haus seit vielen Jahren und im Besonderen die damit verbundene
Geschichte. Natürlich hätte er uns gern die vielen plastischen
Figuren gleich zu Beginn an der Außenfassade gezeigt. Vor allem die
berühmten neun Dichterbüsten über den Fenstergiebeln mit Friedrich
Halm, Franz Grillparzer, Friedrich Hebbel, Friedrich Schiller, Johann
Wolfgang Goethe, Gotthold Ephraim Lessing, Moliere, William
Shakespeare und Calderon de la Barca. Doch eine planmäßige
Rekonstruktion der Außenhaut machte uns einen Strich durch die
Rechnung.
Im Burgtheater selbst kam keine Sekunde
Langeweile auf. Es gab ja eine Menge zu besichtigen und zu erfahren:  Der Zuschauerraum mit seinen 1175 Sitz- und 85 Stehplätzen, die Vor-,
Haupt- und Hinterbühne, auf der 270 Techniker im 3-Schichtbetrieb
damit beschäftigt sind, ein fast täglich wechselndes Theaterprogramm
von September bis Juni abzusichern, das System der Drehzylinderbühne
mit integrierter Versenkung,
Der Zuschauerraum mit seinen 1175 Sitz- und 85 Stehplätzen, die Vor-,
Haupt- und Hinterbühne, auf der 270 Techniker im 3-Schichtbetrieb
damit beschäftigt sind, ein fast täglich wechselndes Theaterprogramm
von September bis Juni abzusichern, das System der Drehzylinderbühne
mit integrierter Versenkung,  welches 1941 nach Entwürfen von Prof.
Sepp Nordeggs entwickelt wurde und in der ganzen Welt Nachahmer
gefunden hat oder die Ehrengalerie mit einer Gemäldesammlung, die
einen umfassenden Überblick über die Großen der Schauspielkunst der
letzten zweihundert Jahre am Burgtheater vermittelt. welches 1941 nach Entwürfen von Prof.
Sepp Nordeggs entwickelt wurde und in der ganzen Welt Nachahmer
gefunden hat oder die Ehrengalerie mit einer Gemäldesammlung, die
einen umfassenden Überblick über die Großen der Schauspielkunst der
letzten zweihundert Jahre am Burgtheater vermittelt.
Von all der nicht immer harmonisch verlaufenden Gemeinschaftsarbeit
der beiden Architekten dieses Hauses, Gottfried Semper und Carl von
Hasenauer, haben wir während der Führung nichts verspürt. Im
Gegenteil, es war festzustellen, dass Kompetenzschwierigkeiten und
Anfeindungen nicht zum Ausschluss von hervorragenden Leistungen in der
Baukunst führen müssen.
Über die im Zweiten Weltkrieg verschont gebliebenen Feststiegen
erhielten abschließend einen repräsentativen  Eindruck vom ursprünglichen Glanz des Burgtheaters. Ihr schönster Schmuck sind
ihre fünf Deckengemälde, die von Franz Matsch und dem Brüderpaar
Gustav und Ernst Klimt in erstaunlicher Harmonie und mit
wechselseitiger Einfühlung gemalt wurden. Ein heiterer, verspielter
Gang durch die Geschichte des Welttheaters, eine Hommage an seine
Dichter und Mimen.
Eindruck vom ursprünglichen Glanz des Burgtheaters. Ihr schönster Schmuck sind
ihre fünf Deckengemälde, die von Franz Matsch und dem Brüderpaar
Gustav und Ernst Klimt in erstaunlicher Harmonie und mit
wechselseitiger Einfühlung gemalt wurden. Ein heiterer, verspielter
Gang durch die Geschichte des Welttheaters, eine Hommage an seine
Dichter und Mimen.
Der für Otto-Normal-Besucher eher karge Ansatz für
Fragestellungen ist in unserer Gruppe größer, vielleicht auch
machbarer, da wir auf Dinge stoßen, die uns aus Dresden vertraut und
bekannt sind oder mit den heimatlichen Gefilden im Zusammenhang
stehen. Zu gern möchten wir den Besuchsrahmen sprengen. Doch Herr
Heindel hat eben die Arbeit begonnen, die gemacht werden muss, damit
die Vorbereitungen für die Abendveranstaltung anlaufen.
Das Zusammenrücken für ein abschließendes
Gruppenfoto macht uns den Abschied leichter. Einen Moment lang
blockieren wir mit einem zufriedenen lächeln den Haupteingang und
verewigen uns für das Clubarchiv:

Gottfried Semper-Club Dresden e.V.
Wienexkursion, 25.Mai 2002, vor dem Burgtheater. Erbaut in den
Jahren 1874-1888 von Gottfried Semper und Carl von Hasenauer. Und ich
setze noch eine Anmerkung dazu: endlich einmal ein Foto, worauf ich
auch zu sehen bin!
Wir laufen in kleineren Gruppen durch den Volksgarten,
schlendern auf dem Heldenplatz vor der Hofburg 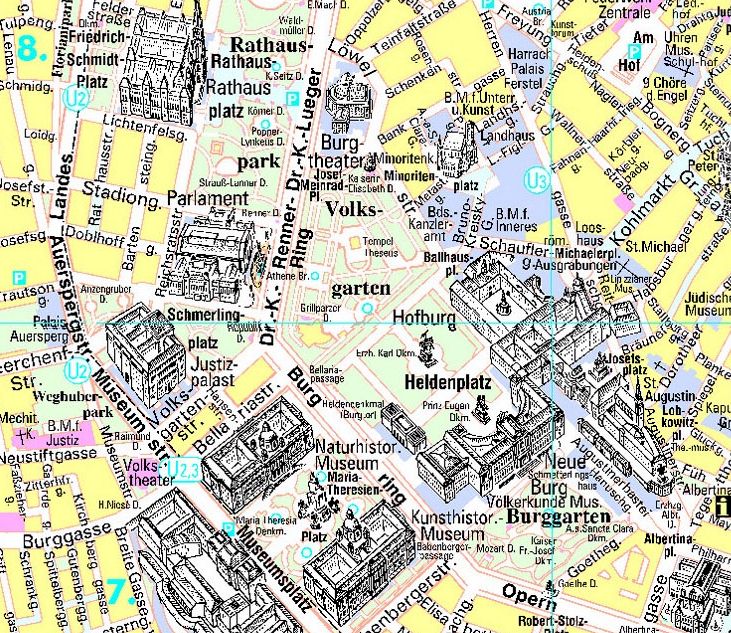 und
überqueren die Ringstraße zu den nahe gelegenen Hofmuseen. und
überqueren die Ringstraße zu den nahe gelegenen Hofmuseen.
Aus einem Jahrzehnte dauernden Architekturstreit ist
ein weltweit einzigartiges Ensemble entstanden und förmlich zu
spüren, wie viele namhafte Architekten und Künstler darum
rangen, ihre Konzepte geradezu an diesem Ort zu hinterlassen.
Vor den reich instrumentierten Fassaden der
Museumsbauten erhalten wir von Lucas Müller eine Einführung. Der
Mittelrisalit ist der zentrale, markanteste und wichtigste Bauteil des
Hauses. Hier ist der monumentale Eingang zu den  Schausammlungen
und wird von der großen, der eines Doms gleichen Kuppel und ihren
Trabanten überragt. Obwohl der Dresdner Sempergalerie das gleiche
Prinzip zugrunde liegt, präsentiert sich die Architektur an diesen
Hofmuseen als Monument. Solch eine aufwendige Verwirklichung, wie wir
vorbereitet werden, wird noch um ein mehrfaches im Inneren, vor allem
im Treppenhaus und den angrenzenden Hallen namentlich des
Kunsthistorischen Museums überboten. Schausammlungen
und wird von der großen, der eines Doms gleichen Kuppel und ihren
Trabanten überragt. Obwohl der Dresdner Sempergalerie das gleiche
Prinzip zugrunde liegt, präsentiert sich die Architektur an diesen
Hofmuseen als Monument. Solch eine aufwendige Verwirklichung, wie wir
vorbereitet werden, wird noch um ein mehrfaches im Inneren, vor allem
im Treppenhaus und den angrenzenden Hallen namentlich des
Kunsthistorischen Museums überboten.


Wir trennen und als Gruppe und ruinieren unser
physisches und psychisches Leistungsvermögen an den mäzenatischen
Tugenden bzw. den über Jahrhunderte zusammengetragenen Kunstschätzen
des habsburgischen Kaiserhauses.


Wir sind, den anstrengenden Besuch des Kunsthistorischen und
Naturhistorischen Museums hinter uns liegend, für zweieinhalb
Stunden auf uns selbst gestellt. Jeder der Clubmitglieder hat die
Eigenverantwortung für die Reproduktion seiner Kräfte übernommen.
Wir kennen zwar nicht die einzelnen Wünsche oder Ziele, können aber
selbst im Stadtgemenge ablesen, dass es die meisten ins Zentrum drängte.
Tatsächlich hat das Wiener Stadtzentrum eine ganz
einzigartige Ausstrahlung. Nicht nur, dass es überfüllt von
faszinierenden Häusern, Villen, Kirchen, Plätzen,
Läden und Kaffees ist, das bauliche Ensemble scheint hier
Unmengen von fröhlichen, aufgeschlossenen, entgegenkommende und
lustigen Menschen anzuziehen und sie wie ein Magnet in einem sicherem
Umkreis festzuhalten.
Von den unzähligen Essenverkaufsständen fällt uns
einer auf dem "Graben" ganz besonders ins Auge. Er ist eine
Mischung aus Bäckerei, Obst- und Getränkehandlung, Jahrmarktstand
und Festzelt, in dem eine gastronomische Kleinkunst geboten wird und deren Bodenständigkeit aus dem ländlichen Umfeld förmlich zu "riechen"
ist. Ich esse zwei riesengroße frische Schwarzbrotscheiben, vor meine
Augen bestrichen mit verschiedenen Kräuterschmalzarten, dazu Salzgurken und
ein Pilsner.
Ohne ein Stückchen Kuchen doch noch zu probieren, konnte ich mich von
diesem Ort nicht trennen.
Gestärkt, laufen wir am Stephansplatz in ein Netz von kleinen
Gassen. Es ist ein angenommener Weg, den wir Richtung Treffpunkt vor
dem Museum für Angewandte Kunst (MAK) einschlagen. Erfreulicher Weise habe
ich bereits in der kurzen Zeit die Räumlichkeit der Stadt Wien in
mich aufgenommen und war mit dem Ergebnis, den Wiener Kursalon im
Stadtpark zu
erblicken, überaus zu frieden. Eine spätere Recherche im
Stadtplan jedoch rang mir ein Schmunzeln ab, denn so gut ward dieser
doch nicht getroffen, wenn ich davon ausgehe, optimal mein Ziel zu
erreichen. In unserem Fall trat überhaupt kein Schaden ein, in
Gegenteil, wir und siehe da auch andere Clubfreunde suchten hier vor
dem Sturm noch die verdiente Ruhe.
Die Tatsache, dass das MAK  oberflächlich betrachtet
kein Wiener Bau ist, der den vielen bereits erwähnten vom
Bekanntheitsgrad oder der Architektur her Konkurrenz machen könnte,
ist Dr. Franz, Custus des Hauses und unser überaus sach- und
fachkundiger Begleiter, wohl bekannt. Näher betrachtet und von Dr.
Franz wunderbar offeriert, stellt stellt sich jedoch heraus, dass sich
das MAK mit seiner einzigartigen Sammlung von angewandter und
zeitgenössischer Kunst und Architektur überaus erfolgreich
international und avantgardistisch präsentiert. oberflächlich betrachtet
kein Wiener Bau ist, der den vielen bereits erwähnten vom
Bekanntheitsgrad oder der Architektur her Konkurrenz machen könnte,
ist Dr. Franz, Custus des Hauses und unser überaus sach- und
fachkundiger Begleiter, wohl bekannt. Näher betrachtet und von Dr.
Franz wunderbar offeriert, stellt stellt sich jedoch heraus, dass sich
das MAK mit seiner einzigartigen Sammlung von angewandter und
zeitgenössischer Kunst und Architektur überaus erfolgreich
international und avantgardistisch präsentiert.
Ein positiver Aspekt des MAK der uns doch überrascht,
wenn man an seine gegenwärtigen Herausforderungen als zentrale
Schnittstelle globaler Kommunikation für Kunst und Architektur denkt,
ist der Umstand, dass wir sehr oft von Dr. Franz auf die bis in unsere
Zeit wirkende Beziehung von Gottfried Semper mit der Systematik dieses
Hauses aufmerksam gemacht werden. Sicherlich stellt sich die Arbeit im
MAK, wie er uns erklärt, als intensive Auseinandersetzung mit
zeitgenössischen Kunst- und Architekturströmungen dar, aber im
Grundsatz wird diese bestimmt wie zu Sempers Zeiten: Ein Diskurs über
Form menschlicher Wahrnehmung, die entlang von Grenzen navigiert, die Kunst und Erkenntnis von den unzähligen modischen Formen von Konsum,
Unterhaltung und Erlebnis trennt, die sich hinwegsetzt oder
kapituliert vor dem Gesellschaftsmodell einflussreicher
Persönlichkeiten und Gesellschaften. uns doch überrascht,
wenn man an seine gegenwärtigen Herausforderungen als zentrale
Schnittstelle globaler Kommunikation für Kunst und Architektur denkt,
ist der Umstand, dass wir sehr oft von Dr. Franz auf die bis in unsere
Zeit wirkende Beziehung von Gottfried Semper mit der Systematik dieses
Hauses aufmerksam gemacht werden. Sicherlich stellt sich die Arbeit im
MAK, wie er uns erklärt, als intensive Auseinandersetzung mit
zeitgenössischen Kunst- und Architekturströmungen dar, aber im
Grundsatz wird diese bestimmt wie zu Sempers Zeiten: Ein Diskurs über
Form menschlicher Wahrnehmung, die entlang von Grenzen navigiert, die Kunst und Erkenntnis von den unzähligen modischen Formen von Konsum,
Unterhaltung und Erlebnis trennt, die sich hinwegsetzt oder
kapituliert vor dem Gesellschaftsmodell einflussreicher
Persönlichkeiten und Gesellschaften.
 Museen diese Art gibt es nur wenige auf der Welt. Das
liegt einerseits daran, dass Anschaffungen als Grundlage für die
Arbeit der Künstler selbst erst mit der Zeit zu musealen Objekten
werden und andererseits an der Prämisse, dass nur die konkrete
Intervention der Künstler diese Verhältnisse ermöglichen. Museen diese Art gibt es nur wenige auf der Welt. Das
liegt einerseits daran, dass Anschaffungen als Grundlage für die
Arbeit der Künstler selbst erst mit der Zeit zu musealen Objekten
werden und andererseits an der Prämisse, dass nur die konkrete
Intervention der Künstler diese Verhältnisse ermöglichen.
Eine vitale Institution zwischen Praxis und Lehre,
Kunst und Industrie, Produktion und Reproduktion, eine Forum des
Widerstandes gegen den Bedeutungsverlust im Zuge der verallgemeinerten
Beliebigkeit zu werden, obliegt eigenen Gesetzmäßigkeiten vor Ort
und bestimmt darüber die unverrückbare Position des MAK. -
Dieser Befund ist Ansatz für unseren Vorsitzenden, noch mehr über
dieses Haus und seine Ansprüche zu erfahren und eine Einladung an Dr.
Franz zu einem Clubabend nach Dresden auszusprechen.
Ich sehe, was ich noch nie mit eigenen Augen zuvor
gesehen habe: eine theoretische Abhandlung Gottfried Sempers im
Original. Die "Vier Elemente der Baukunst", die zu den
wertvollsten Handschriften der MAK-Bibliothek gehört, wird speziell
für uns präsentiert. Ich erkenne mühsam die verblasste Schrift, die,
zugegebener Maßen ich bei kräftigeren Konturen auch nicht hätte
entziffern können, und glaube in die Zeit Sempers zu fallen. Ich
stehe auf einmal in einer anderen Welt, einer Welt, die auf die
Größe dieser Bibliothek
geschrumpft ist. theoretische Abhandlung Gottfried Sempers im
Original. Die "Vier Elemente der Baukunst", die zu den
wertvollsten Handschriften der MAK-Bibliothek gehört, wird speziell
für uns präsentiert. Ich erkenne mühsam die verblasste Schrift, die,
zugegebener Maßen ich bei kräftigeren Konturen auch nicht hätte
entziffern können, und glaube in die Zeit Sempers zu fallen. Ich
stehe auf einmal in einer anderen Welt, einer Welt, die auf die
Größe dieser Bibliothek
geschrumpft ist.
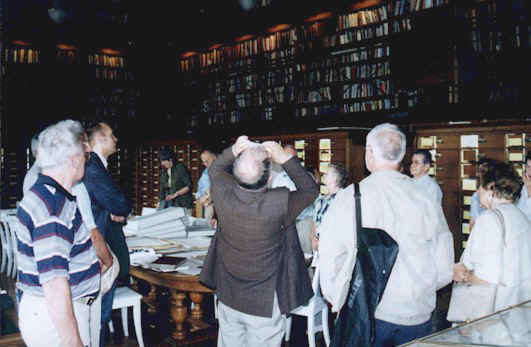

Sonntag, 26.05.2002
Am zweiten Morgen sind wir wieder früh auf den Beinen. Wer gekommen ist,
die großartigen Semperbauten zu sehen, besucht auch die anderen Attraktionen dieser
Stadt. Keine noch so berühmte Sehenswürdigkeit ist eine Konkurrenz für die andere,
sondern zieht nur das Ganze noch mit sich. Getreu dieser Auffassung erwartet uns erneut
ein umfangreiches Besucherprogramm.
Es drängt uns kein Termin. Zum Glück, denn der 19. Vienna City Marathon
mit 25000 Läufern, wie wir aus der Zeitung später entnehmen werden, beeinflusst
unseren Tagesstart. Abfahrt ist der Parkplatz am Wiener Prater. 10 Minuten Fußweg vom
Hotel durch Absperrungen, noch unproblematisch und im festen Glauben, sich auf die
richtige Seite der durch das Ereignis "geteilten" Stadt zu begeben.
Nur
wenige Kreuzungen nachdem wir unsere Fahrt angetreten haben ist offensichtlich, dass unser
erstes Ziel auch von hier aus nicht so ohne Weiteres angepeilt werden kann. Wir finden
immer wieder frei befahrbare Wegstrecken. Doch die Möglichkeit der Navigation in einem
System von unbekannten Straßensperren ist dem reinen Zufall unterworfen. Nach 50
Minuten ist das Labyrinth entschlüsselt und die Auswirkungen des Marathonlaufes verlieren
an Bedeutung. Aufmerksamkeit wird jetzt nur noch dem KunstHausWien zu Teil. Labyrinth entschlüsselt und die Auswirkungen des Marathonlaufes verlieren
an Bedeutung. Aufmerksamkeit wird jetzt nur noch dem KunstHausWien zu Teil.
Das
mehr unter dem Namen Hundertwasserhaus bekannte Gebäude zählt zu den faszinierendsten
Bauten Wiens. Jeden Tag kommen Hunderte von Touristen aus allen Herren Länder hier her,
um, wie es F. Hundertwasser selbst formulierte, das erste Bollwerk gegen eine falsche
Ordnung der geraden Linie, den ersten Brückenkopf gegen das Rastersystem und gegen das
Chaos des Nonsens zu sehen. den faszinierendsten
Bauten Wiens. Jeden Tag kommen Hunderte von Touristen aus allen Herren Länder hier her,
um, wie es F. Hundertwasser selbst formulierte, das erste Bollwerk gegen eine falsche
Ordnung der geraden Linie, den ersten Brückenkopf gegen das Rastersystem und gegen das
Chaos des Nonsens zu sehen.
In Wien
wird gesprochen von der dritten Haut im dritten Bezirk. Der Mensch, so heißt es, ist von
drei Schichten umgeben, von der Haut, von der Kleidung und von den Mauern, dem Gebäude.
Kleidung und Gebäudemauern haben in der letzten Zeit eine Entwicklung genommen, die nicht
mehr den Naturbedürfnissen des einzelnen entsprechen. Das KunstHausWien hätte gezeigt,
wie dringend Schönheitshindernisse benötigt werden, diese Schönheitshindernisse
bestehen demnach aus unreglementierten Unregelmäßigkeiten.
Wie auf
einer Minigolfanlage werden wir gezwungen, auf unebener Erde zu laufen. Auch diese
Gestaltungsart, der des welligen Bodens, gehört zum Architekturkonzept Hundertwassers.
Und irgend wie kann ich in diesen
 Augenblicken seiner Intuition folgen, wenn er behauptet,
dass ein belebter, unebener Fußboden eine Wiedergewinnung der Menschenwürde bedeutet,
die dem Menschen im nivilierten Städtebau entzogen wurde. Man wird gerne auf dem unebenen
Boden auf und ab gehen, um sich zu erholen und um das menschliche Gleichgewicht
wiederzufinden Augenblicken seiner Intuition folgen, wenn er behauptet,
dass ein belebter, unebener Fußboden eine Wiedergewinnung der Menschenwürde bedeutet,
die dem Menschen im nivilierten Städtebau entzogen wurde. Man wird gerne auf dem unebenen
Boden auf und ab gehen, um sich zu erholen und um das menschliche Gleichgewicht
wiederzufinden
Vom
Oberen Belvedere aus kontrollieren wir am späten Vormittag das Stadtbild, wie Canaletto
es genau 10 Jahre nach seiner berühmten Stadtansicht über Dresden für Wien gemalt hat.
Natürlich hat sich der Wiener Canaletto-Blick verändert, doch im Wesentlichen, wenn ich
mich an die Betrachtung dieses Bildes im Kunsthistorischen Museum gestern erinnere, ist er
es immer noch.Unsere Besichtigungstour weiter durch den Schlosspark zum Unteren
Belvedere mit der Orangerie in Richtung Karlskirche und Naschmarkt führt uns an Orte, an
denen Wien weitere kräftige architektonische Wegmarken setzte. Und an solchen Gebäuden
geht heute kein ausgeschlafener Wienbesucher einfach vorbei: an Otto Wagners
 Karlsplatzpavillon, an Josef Maria Olbrichs SEZESSION
Karlsplatzpavillon, an Josef Maria Olbrichs SEZESSION 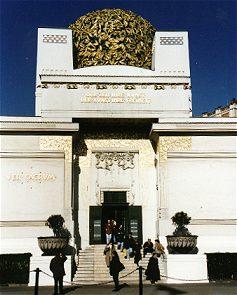
oder am Prachtboulevard der Linken
Wienzeile mit dem Majolikahaus".
 
Nur drei Beispiele aus der Fülle von
Jugendstilarchitektur, die dem Gesicht der Wiener Stadt ein unvergleichliches Make-up
verpassen.
 Es ist früher Nachmittag, als wir mit unserem Bus vor das Schloss
Schönbrunn vorfuhren. Angesichts der weit über 5,2 Millionen Besucher, den die Schlossanlage,
der Park und alle anderen Einrichtungen jährlich anzieht, quirlte und wirbelte es
überall auch bei unserem Eintreffen. Schönbrunn ist, das spürten wir sofort, eine
Welttouristenattraktion und zugleich das(!) Naherholungsgebiet für die Wiener
Bevölkerung. Wir trennen uns von der Gruppe am Haupteingang und lösen Karten für die
kleine Besichtigungsvariante. Es ist früher Nachmittag, als wir mit unserem Bus vor das Schloss
Schönbrunn vorfuhren. Angesichts der weit über 5,2 Millionen Besucher, den die Schlossanlage,
der Park und alle anderen Einrichtungen jährlich anzieht, quirlte und wirbelte es
überall auch bei unserem Eintreffen. Schönbrunn ist, das spürten wir sofort, eine
Welttouristenattraktion und zugleich das(!) Naherholungsgebiet für die Wiener
Bevölkerung. Wir trennen uns von der Gruppe am Haupteingang und lösen Karten für die
kleine Besichtigungsvariante.
Jede habsburgische Herrscherfamilie scheint hier, eine eigene Um-, Anbau-
und Ausstattungsperiode hinterlassen zu haben. Viele unterschiedliche Galerien, Festsäle,
Appartements und Gemächer sowie privates Interieur gibt es dadurch zu bewundern. Wir sind
Besucher unter Besuchern, deutsche Touristen unter Touristen aus allen Herren Länder. Und
doch haben wir eine einheitliche Besuchersprache. Äußerlich sichtbar werden
die Emotionen aller Besucher im Arbeitszimmer Kaiser Franz Josephs I., im Schlaf- und Sterbezimmer Kaiser
Franz Josephs I., im Toilettenzimmer der Kaiserin Elisabeth, im Napoleonzimmer, im
Schreibzimmer der Erzherzogin Sophie oder im Salon der Kaiserin Elisabeth - ein Lächeln,
eine Betroffenheit oder Anerkennung, große Neugierde ob der privaten Gegenstände und
Lebensgewohnheiten. Wahrscheinlich auch geschuldet dem Mythos, der Kaiser Franz Joseph
und seine Gemahlin Elisabeth, auch unter ihrem Kosenamen Sisi bekannt, umgibt.
 Wir laufen auf die Anhöhe des Schönbrunner Berges zur Gloriette. Es ist die weiteste
Strecke, die wir in der Parklandschaft zurücklegen können. Eigentlich hatten wir keinen
Bock mehr darauf, wären nicht die noch eineinhalb Stunden bis zur Busabfahrt gewesen.
Plötzlich hatten wir ein Luxusplätzchen entdeckt. Galerien in einer elfachsigen
Arkadenreihe auf dorischen Säulen, Wir laufen auf die Anhöhe des Schönbrunner Berges zur Gloriette. Es ist die weiteste
Strecke, die wir in der Parklandschaft zurücklegen können. Eigentlich hatten wir keinen
Bock mehr darauf, wären nicht die noch eineinhalb Stunden bis zur Busabfahrt gewesen.
Plötzlich hatten wir ein Luxusplätzchen entdeckt. Galerien in einer elfachsigen
Arkadenreihe auf dorischen Säulen,  dazwischen ein Mitteltrakt. Heiße Schokolade und Eis
im Café Gloriette - eines der schönsten Cafés Österreichs - und vor allem die Aussicht
über Wien und seine dazwischen ein Mitteltrakt. Heiße Schokolade und Eis
im Café Gloriette - eines der schönsten Cafés Österreichs - und vor allem die Aussicht
über Wien und seine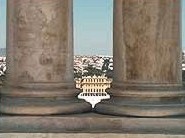 Umgebung dazu: alles perfekt. Umgebung dazu: alles perfekt.
Abschied und Heimreise
Abends in
Griechenbeisel, übrigens dem ältesten Gebäude der Stadt, galt es von Wien offiziell
Abschied zu nehmen. Wir haben erstmals wieder Zeit, dem Dschungel von Wiener Architektur,
Kunst, Persönlichkeiten, Sehenswürdigkeiten und Geschichten entgegenwirkend, uns
mit Anderem zu beschäftigen, das auch noch Bedeutung hat oder Notwendig ist. Für
den einen war es die gedankliche Vorbereitung auf die Abreise, für den anderen einfach
nur ein Kompromiss aus Entscheiden müssen, das richtige Gericht aus der umfangreichen
Speisekarte des altehrwürdigen Hauses herauszufinden, dieses mit Zeigefinger auf Richtung
Gesundheit zu überprüfen und mit dem Ambiente eines Bidermeierstüberl oder
Jagdzimmer in Einklang zu bringen.
Ich persönlich vermochte diese Abschiedsstimmung an diesem Abend nur in
Beziehung zu meinen Gefühlen zu bringen, die im Begriff waren, unsere Reise in eine
Seinsform zu bringen. Ist sie doch ein Ereignis aus lauter kleinen und liebenswürdigen
Begebenheiten, die, um bewahrt zu werden, in ein Aussehen zurücktransformiert werden müssen.
Und sei es in eine kleine Reisegeschichte. Unser Nachhausekommen ist deshalb für mich
eigentlich kein Abschied, es ist eine spannende Suche nach einer Ordnung, die mir Wien,
und wenn es mir gelingt auch anderen Clubfreunden, in bleibender Erinnerung belässt.
Man muss nicht zu den schärfsten Beobachtern gehören und aus den
Tiefen des Gemüts schöpfen, um unserer abreisebereiten Gruppe anzumerken,
dass der für eine Reise viel zitierte Ausspruch: das Neue ist all zu oft das
Alte, bei uns seine Relativierung erfährt. Zwar ist unsere Gesellschaft
am vierten Tag wie viele unser Touristenkollegen von Übermüdung, Erschöpfung und
Überflutung an Reizen geplagt, mit Eindrücken beschäftigt, die sie an das bereits
Gesehene oder Geschriebene binden. Dagegen steht aber eine Fröhlichkeit ins Gesicht
geschrieben, Wien Dank der vielen sachkundigen Referenten als kommunizierbare Stadt
kennengelernt zu haben und zu unbeschreiblichen und heiligen Orten vorgedrungen zu sein.
Unser Bus setzt sich 7.30 Uhr in Bewegung. Prag ist unser nächstes
Reiseziel. Ein mit viel Logik vorbereiteter Stationsaufenthalt, bei dem wir in
abgewandelter Form Architekturkonzepte der Ringstraße vorfinden werden und Arbeiten
von Künstlern, die in Wien wirkten, auch in der Goldenen Stadt bewundern können.
Die Feststellung der Tschechischen Grenzbeamten, dass das von Österreich
ausgestellte vorläufige Dokument zum Verlust des Personalausweises für eine Fahrt durch
ihre Republik nicht privilegiert ist, löst bei uns allen Unruhe aus. Der Tatbestand, der
für unser betroffenes Clubmitglied allein schon tragisch genug ist, fällt auf
unerwartete Weise auf uns alle hernieder. Die Reiseorganisation berät
vor der am Busbug
aufgespannten Landkarte und entwickelt eine Idee, mit der all unsere Reisefreunde nicht
nur leben können, sondern das "verloren gegangene" Prag auch verschmerzen
lassen. Reiseorganisation berät
vor der am Busbug
aufgespannten Landkarte und entwickelt eine Idee, mit der all unsere Reisefreunde nicht
nur leben können, sondern das "verloren gegangene" Prag auch verschmerzen
lassen.
Wir legen mit dem Bus eine Strecke von 430 km zurück. Wieder Richtung
Wien, Steinhäusel, Linz, Wels, Ried im Innkreis, Grenzübergang Suben, Deggendorf. Wir
verlassen die Autobahn bei Wörth a.d. Donau/Wiesent. Noch 15 km.
Die Walhalla in Donaustauf,  ein mächtiger Mamorbau, präsentiert sich vor
uns. Ich bin über mich selbst überrascht, denn ohne diesen Ort je zu vor besucht zu
haben und gierig darauf zu sein, diesen ohne Vorbehalte zu betreten, beschäftigen sich
meine Gedanken im Vorfeld mit den "strittigen" Problemen um dieses
Gebäude. ein mächtiger Mamorbau, präsentiert sich vor
uns. Ich bin über mich selbst überrascht, denn ohne diesen Ort je zu vor besucht zu
haben und gierig darauf zu sein, diesen ohne Vorbehalte zu betreten, beschäftigen sich
meine Gedanken im Vorfeld mit den "strittigen" Problemen um dieses
Gebäude.
Warum ist das nur so? Warum ist für mich gerade jetzt wichtig, dass
eigentlich die Walhalla kein Wahrzeichen von Donaustauf ist, umrahmt von den Ausläufern
des Bayrischen Waldes erhebt sie sich auf dem so genannten Bräuberg, zwischen Donaustauf
und Sulzbach. Man sollte richtigerweise Walhalla bei Donaustauf sagen. Warum fallen mir
plötzlich die Kritiken vieler Persönlichkeiten unserer Gesellschaft ein, die meinen, zu
wenig Frauen finden Eingang in diesen Ruhmestempel. Warum bin ich aufgeregt, wenn ich in
den auszuliegenden Publikationen Formulierungen vom bedeutendsten klassizistischen
Bauwerk des 19.Jahrhunderts lese?
Reisemüdigkeit? Vielleicht ja, vielleicht nein.
Ich bin, und darüber freue mich ich mich natürlich, noch fähig, zu
Verdrängen und
die wunderbaren Seiten des Gebäudekomplexes sowie die Schätze im Inneren der Walhalla in
mich aufzunehmen. Allein so viele Arbeiten von Schadow, Rauch, Tieck oder Rietschel auf
einmal bewundern zu können, Künstlern, deren Leben und deren Arbeiten mir durch Dresden,
ja selbst über meine Führungen im Belvedere Schöne Höhe in Dittersbach/Elbersdorf
vertraut sind, war ein unwiederbringliches erstes Mal, dem ein zweites und ich weiß nicht
folgen wird.
Wir setzen Rayk fasst bei Langsamfahrt am Neustädter Bahnhof ab, damit er
seinen letzten Zug nach Berlin noch erreicht.
Ich spüre und erlebe ähnlich der Abfahrt, dass
auch die Ankunft eine aufwühlend bewegende Angelegenheit ist. Selbst das
faszinierende Panorama der beleuchteten Semperoper, welches uns den Augenblick eines herzlichen
Empfangs von Semper persönlich suggeriert, kann diesem letzten
Eindruck unseres
Reisegeschehens nichts entgegensetzen.
|